Dieser Artikel zum Thema Hawaii erschien kürzlich in der Schweizer Tageszeitung Tagesanzeiger.
Ich traf die Autorin des Artikels und freue mich den Artikel auf meinem Blog zu veroeffentlichen und spaeter zu kommentieren.
Surfen als Segen und Fluch für Hawaii
Von Susanne Loacker. Aktualisiert am 07.11.2008
Aus aller Welt strömen Surfer nach Hawaii, um sich mit den «Jaws» und «Pipes» zu messen, den einmaligen Wellen. Doch am Geburtsort des modernen Surfens herrscht nicht nur Freude über die Fremden.
«I Am the Future», prangt vielversprechend auf dem neonpink leuchtenden Surfshirt eines Knirpses. Und auf seinem Rücken liest man «Rabbit Is My Uncle». Dasselbe Shirt in Gelb, Orange und Hellblau tragen an diesem Tag unzählige Kids an der Queen’s Beach von Waikiki.
Heute beginnt das Duke Ocean Fest, Duke Kahanamokus Geburtstagsparty. Schon um 7 Uhr morgens hat vor der Statue des Vaters aller Surfboys eine Zeremonie stattgefunden, Hulatänzerinnen sind aufgetreten, um Dukes Brust und Arme werden Blumenkränze drapiert. Später halten der Bürgermeister und ein Vertreter von National Geographic ihre Ansprachen bei der Lagune in Waikiki, wo Duke aufwuchs. Unterdessen gehört diese nach ihm benannte Lagune zum Hotel Hilton.
Der Onkel
Surfboys fortgeschrittenen Alters, die den 1968 verstorbenen Meister noch kannten, paddeln auf ihren Boards über die Lagune. Einer von ihnen, der jetzt ebenfalls beim Hilton eingetroffen ist, um den grossen Duke zu ehren, ist Uncle Rabbit, dessen Name auf den bunten Shirts der Kids steht. Der 88-jährige Rabbit Kekai leitet eine Stiftung, die Kindern das Surfen ermöglicht. An Dukes Geburtstag findet in Waikiki ein Wettbewerb der 4- bis 6-Jährigen statt. Rabbit Kekai selber ist auch noch jeden Morgen mit seinem Board draussen in den Wellen. «Manchmal stehe ich gar nicht auf, sondern paddle bloss so herum», lacht er. «Täte ich das nicht, käme ich mir sofort sehr alt vor.» Kekai bevorzugt in seinen hohen Jahren die freundlich rollenden Wellen von Waikiki Beach. Vor allem im Sommer, bei Süd-Dünung, bekommt Waikiki genügend Wellen zwischen einem halben und einem Meter, wie sie auch ideal für Anfänger sind.
Unzählige Surflehrer bieten Kurse an und versprechen, dass man es «garantiert» schaffe, schon in der ersten Lektion aufzustehen. Wer es noch nicht ganz hinbekommt, übt fleissig: Wenn zwischen sechs und sieben Uhr morgens die Sonne erst langsam über die Hotelburgen an der Queen’s Beach von Waikiki steigt, hocken draussen in der Bucht schon unzählige Surfer auf ihren Brettern und warten auf Wellen.
Der Ambassador
Der Einzige, der seinen zahlreichen eifrigen Jüngern und ihren Lehrern nicht zusehen kann, ist Duke Kahanamoku selber. Seine überlebensgrosse Bronzestatue steht mit dem Rücken zum Meer. Ironie der Heldenverehrung, hat doch der legendäre Schwimmer, der an allen Olympiaden von 1912 bis 1924 Medaillen gewonnen hat, genau davor gewarnt: «Never turn your back on the ocean.» Er konnte damals freilich nicht ahnen, dass sein Standbild das meistfotografierte Sujet von Waikiki werden würde, natürlich mit seinem Meer als Hintergrund.
Fast wäre es den christlichen Missionaren im 19. Jahrhundert gelungen, das Wellenreiten, das mit grosser Wahrscheinlichkeit die Polynesier erfunden, die Hawaiianer aber weiterentwickelt und mit Kultstatus versehen haben, auszurotten. So viel körperbetonte Spiel- und Daseinslust, in die sich noch dazu in heidnischer Weise Männer und Frauen teilten, erschien ihnen gegen alle guten Sitten. Worin der Sinn dieses Kultsports lag und welche Regeln dafür galten, blieb ihnen verborgen. Männer demonstrierten in friedlicher Weise Mut, Kraft und Geschicklichkeit, Frauen begnügten sich mit kleineren Wellen oder ihrer Rolle als Publikum, die grössten Wellen aber blieben nach den hawaiianischen Kapu-Gesetzen den Königen vorbehalten.
Den Erfolg der Moralapostel verhindert hat Duke Kahanamoku. Er kam 1890 in Honolulu zur Welt und wurde nach alter hawaiianischer Sitte im Meer getauft. Frühzeitig verliess er die trockene Schule und wurde einer der Beachboys, die sich jeden Tag am Wasser trafen, um zu schwimmen und zu surfen.
Das tägliche Training formte Kahanamoku zum Modellathleten. Sein Surfbrett war nach dem Vorbild des traditionellen hawaiianischen Olo-Boards gute fünf Meter lang und wog etwa 100 Kilo. In seiner langen Karriere als Schwimmer, die ihn um die ganze Welt führte, trennte er sich nie von diesem Gerät. So kam dank ihm der hawaiianische Lokalsport nach Australien und Nordamerika. Die Swimming Hall of Fame im floridianischen Ft. Lauderdale hat ihm und seinem Brett ein Denkmal errichtet, in nächster Umgebung zu den Vitrinen und Trophäen von Mark Spitz und anderen Heroinnen und Heroen des Wassers.
Die heutigen Surfbretter sind deutlich kleiner und leichter. Das hat ihre Verbreitung gefördert und sie in Hawaii allgegenwärtig gemacht. Hinter Kahanamokus Bronzerücken reihen sich ganze Racks wie überdimensionale Fahrradständer am Strand, wo die Bretter über Nacht eingelagert werden. Damit nicht genug, an allen Ecken und Enden werden sie zudem als Zitate verwendet. So haben etwa die historischen Schilder in der ganzen Stadt die Form von Surfboards ebenso wie die Türflügel am Eingang zum Burger King.
Die Freaks
Der Norden der Insel Oahu, der berühmte North Shore, ist im Sommer ein stilles Gebiet. Im Winter hingegen, wenn die Dünung aus Norden kommt, sieht man die Gischt der Riesenwellen schon von weitem. Hier wagen sich nur sehr erfahrene Surfer ins Wasser; ein Wipe-out, ein Sturz, kann tödlich enden. Die Küste, obwohl nur eine Autostunde von Waikiki entfernt, ist gleichwohl eine Welt für sich. Hier gibt es keine schicken Geschäfte und keinen Digicam-Tourismus, eine Mall sucht man vergebens. Ein Food Planet mit Sandwiches in XL-Gösse, Vitaminsäften und Fruchtbechern und ein Starbucks, vor dem sich die Surfelite zum Kaffee trifft, bilden die ganze Infrastruktur. Statt in einem Hotelblock logiert man hier in einem kleinen Häuschen, in einem Trailer oder in dem B & B, das die Witwe des Surfers Mark Foo führt, der an Weihnachten 1994 beim Surfen in Kalifornien ertrank.
Der Reporter
In Haleiwa, dem winzigen Hauptort der Nordküste, gibt es ein einschlägiges Museum. Hurricane Bob, der Chef dieser Ausstellung von historischen Surfboards, Fotos und allerhand interessanten Utensilien, hat gerade frei. Für ihn ist Bill Romerhaus eingesprungen, einst aus Kentucky eingewandert und heute im Rentenalter. In den 60er-Jahren hat er alle Surfmagazine mit seinen berühmten Schwarzweissbildern beliefert. «Ich arbeitete mit diesen riesigen 30-Meter-Filmrollen», erinnert er sich noch mit Stolz, «und war schneller als die Konkurrenz. Meine Fotos waren immer schon am nächsten Tag bei den Redaktionen.» Früher, so erzählt er wehmütig, sei hier alles viel friedlicher gewesen.
«Da gab es am North Shore vielleicht hundert Leute, heute sind es zweitausend. Bis vor wenigen Jahren brauchte man hier kein Schloss an seiner Haustüre. Das hat sich geändert. Die ganze Szene ist aggressiver geworden, dazu haben viele Hawaiianer Alkoholprobleme», erzählt Romerhaus und formuliert die misstrauische Haltung vieler Festlandamerikaner sowohl gegenüber den Einheimischen als auch den Touristen.
Unschwer nachvollziehbar ist hingegen, dass die alteingesessenen Surfer nur bedingt Freude über die vielen Fremden empfinden, auch wenn Hawaii schon lange nicht mehr von Zuckerrohr und Ananas lebt, sondern zum Grossteil vom Tourismus.
Die Profis und die Hippies
Seit kurzer Zeit gibt es eine Fährverbindung zwischen Oahu und Maui, der anderen beliebten Destination für Surfer. Die Superferry erspart den umständlichen, wenn auch landschaftlich reizvollen Flug mit der Aloha Airlines. Die Pläne für die Schnellbootalternative sind nicht neu, doch haben einheimische Surfer und Umweltschützer lange und hartnäckig dagegen protestiert.
Natürlich nicht alle. «Ich finde die Superferry extrem praktisch», meint Kay Lenny, mit 15 der jüngste Rider im Team des legendären Robby Naish auf Maui und bereits Star diverser Surffilme. Mit seiner umfangreichen Ausrüstung für Surfen und Windsurfen kommt er mit der Fähre viel schneller und bequemer nach Oahu. Jetzt will der Profisportler, der schon die halbe Welt bereist hat, an den Wettbewerben des «Duke’s» teilnehmen. Lenny lebt mit seiner Familie selbst im Norden von Maui, der sich vom einstigen Zuckerrohrzentrum zu einem weiteren Mekka des Surfsports entwickelt hat. Die Wellen von Hookipa, in vielen Volksliedern besungen, die der Lokalsender Aloha Spirit auf 102,3 FM unter die Leute bringt, sind von Lennys Wohnort nur ein paar Autominuten entfernt. Hier kann man sogar im Sommer surfen, doch nur im Winter auf solchen Riesenwellen, wie sie sich in den weissen Kreuzen über den Uferfelsen in trauriger Erinnerung halten.
Ganz in der Nähe der Bucht von Hookipa liegt das Städtchen Paia. In früheren Zeiten gab es hier eine Zuckermühle. Mit seinen kleinen, bunten Häusern hat sich der Ort den Charme vergangener Tage bewahrt und bietet so einen Rahmen für eine blühende Hippiekultur. Junge Männer in bunten Shorts ziehen mit nackten Oberkörpern, langen, blonden Haaren und Mädchen in langen Röcken am Arm durch die beiden einzigen Flanierstrassen von Paia. Pick-ups und PKWs mit Dachträgern transportieren fast nichts anderes als jene Bretter, die hier die Welt bedeuten. Im biologisch korrekten Supermarkt sucht man vergebens nach Coca-Cola – doch Nutella, das energiereiche Grundnahrungsmittel der Surfer, findet man in extragrossen Dosen.
Auf der anderen Seite von Maui, eine knappe Autostunde von Paia und Hookipa entfernt, lebt der Schweizer Mike Jucker, geschickt positioniert zwischen den Stränden mit Nord-Swell im Winter und Süddünung im Sommer. Seit sechs Jahren arbeitet und surft er hier, Illusionen bezüglich seiner Integration macht er sich jedoch keine: «Ich bin nach wie vor ein Fremder. Die Einheimischen haben im Wasser immer den Vortritt. Es ist besser, sich keine Feinde zu machen. Maui ist klein, da weiss jeder, wer welches Auto fährt.»
Auch in Paia wird man vor den Einheimischen gewarnt, die sich, wie schon einmal Mitte der Siebzigerjahre, gegen zu viele Touristen wehren könnten, wenn sie ihnen ihre Wellen streitig machen: Die Zufahrt zu «Jaws», einer der berühmtesten Wellen etwa 10 Kilometer östlich von Paia, führt durch ein Gebiet, in das man sich als Ausländer besser nicht alleine wagt. Sachbeschädigungen an parkierten Autos sind keine Seltenheit.
Jeder ist ein Surfer
Der Staat versucht, die einheimische Bevölkerung zu schützen, indem er Land nach Vorweis eines hawaiianischen Stammbaums abgibt. Natürlich kommt es vor, dass jüngere Insulaner ihren Besitz mit Gewinn an reiche Kontinentalamerikaner oder Japaner verkaufen und selber abwandern. Viele aber wollen bleiben und würden für kein Geld der Welt von den Pazifik-Inseln weg aufs Festland ziehen. Der Grund ist immer derselbe: «Du musst nur nachfragen», lacht Mike Jucker, «auf Hawaii ist jeder, auch wenn er gar nicht so aussieht, ein Surfer – oder er war es zumindest einmal.»
Wellenritt durch eine «Tube», den Hohlraum einer brechenden Welle. Moderne Bretter sind kleiner und wendiger und erlauben somit waghalsigere Manöver. Im Hintergrund Honolulu.
Duke Kahanamoku, Ur-Beachboy.
(Tages-Anzeiger)


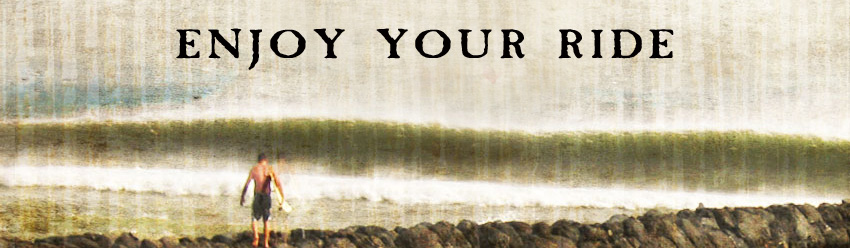
No comments yet.
No one have left a comment for this post yet!